II
1
Vom Schemel neben dem Bett, der Großvater auch als Nachttischchen diente, nahm ich das Buch und schlug es an der Stelle auf, wo zwischen den Seiten ein abgerissenes Stück Zeitung eingelegt war. Immer hatten ihm die aus Leder, Leinen oder Papier gefertigten Lesezeichen leidgetan, die anstatt in Büchern in unaufgeräumten Schubladen und anderen wüsten Ecken seines Hauses vor sich hin schimmelten, während ihre Aufgabe von Bleistiften, Zahnstochern, Münzen und anderen spitzen oder flachen Gegenständen, die gerade bei der Hand waren, wahrgenommen wurde. Sein spätes Leben war eine Ansammlung unbedeutender Details. Angetrocknete Flecken auf den Hemden, angeklebte Essensreste auf den Tellern, verschiedenfarbige Schnürsenkel, durchgebrannte Glühbirnen, angestoßene Gläser, ausgeschriebene Kulis, ungültige Ausweise, längst abgelaufene Horoskope, Schlüssel ohne Schlösser und Schlösser ohne Schlüssel, alles das waren für ihn nur Kleinigkeiten, die niemandem wehtaten und für die sich nicht lohnte, die ihm zugemessene Zeit zu vergeuden.
Wegen des Ablaufens der Stunden stöberte Großvater im Haus auch nie nach Sachen, die für einen bestimmten Zweck geschaffen waren, etwa um zwischen Buchseiten gesteckt zu werden, denn es gab für ihn und seinen selbstverordneten Gleichmut immer genügend andere Dinge in der Nähe, die ebenso wirkungsvoll diese oder eine andere, noch anspruchsvollere Aufgabe erfüllen konnten. Den Kaffee bewahrte er in einem Mayonnaiseglas auf, aus dem er ihn in die džezva schüttete, um ihn dann mit dem Griff des Gasanzünders umzurühren und in einen Joghurtbecher zu gießen, während Großmutters schöne Keramikgefäße für Zucker, Salz und Kaffee, die vergoldeten Kaffeelöffel und Porzellantässchen in der Vitrine Staub ansetzten.
Mutter konnte aus der Haut fahren, wenn er zur Kennzeichnung der Stelle, bei der er beim Lesen stehen geblieben war, seinen Personalausweis verwendete, dann das Buch mit ihm zusammen in die Bücherei zurückbrachte, woher er ihn erst zurückbekam, wenn das Buch erneut ausgeliehen worden war. Dann begab sie sich wütend auf die Jagd nach Lesezeichen, durchwühlte die Schubladen, verrückte die Sessel, Schränke und sogar den Kühlschrank, kroch auch unter die Tische und Betten und legte am Ende völlig außer Atem sieben Lesezeichen auf Großvaters Schemel und schärfte ihm ein, sie endlich auch zu verwenden. Gegen alle Erwartung versprach er ihr, es zu tun.
Aber Großvater las nur abends vor dem Schlafen, in der Nähe des Schemels, und nur wenige der Bücher, die er las, landeten auf ihm, sodass er schon bald wieder alles Mögliche zwischen ihre Seiten steckte, von Visitenkarten der Elektriker bis zu Reklamezetteln der Zeugen Jehovas. Meistens aber riss er einfach ein Stück von der Zeitung ab, und einmal, als er ein wirklich dickes Buch las, ragte aus ihm mehrere Monate lang eine Todesanzeige mit dem Foto der verstorbenen Julija Morosin heraus.
Ihr schicksalsergebenes Gesicht sah mich vom Tisch im Wohnzimmer an, von der Lehne an Großvaters Sessel, vom Ofen, von der Kommode im Vorzimmer, sogar vom Fußboden im WC. Mehrere Male zählte ich ihre achtundsiebzig Jahre, ihre drei Töchter nebst Familien und die Tage bis zum Begräbnis, bevor ich aus Rücksichtnahme meinen Blick vor ihr abzukehren begann, bis ich die arme Julija endlich ihrer postumen Pflichten entband und sie ganz im großväterlichen Stil durch die Hälfte eines Artikels über eine Segelregatta ersetzte.
Und obwohl die Dinge in seinem Haus eine unermessliche Freiheit genossen und die Badezimmerhandtücher sich auf dem Boden des Schlafzimmers sonnten und die Wörterbücher auf der WC-Muschel ruhten, war mein zerstreuter Großvater ein außerordentlich disziplinierter Leser. Seine Lektüre beendete er nie mitten auf der Seite, geschweige denn mitten im Satz. Wenn er las, ließ er sich nicht stören, auch wenn die Hausglocke läutete oder etwas Graupenähnliches auf dem Küchenherd brodelte. Ein Kapitel las er immer von Anfang bis Ende, und wenn die Kapitel zu lang waren, hörte er mit dem Lesen am Ende des ersten Absatzes auf der linken Seite auf. Deshalb war es einfach festzustellen, wo Großvater am Abend zuvor seine Lektüre beendet hatte, welcher Satz der letzte war, den er im Leben gelesen hatte.
Ich schlug das Buch, das ich auf dem Schemel vorgefunden hatte, dort auf, wo das Stückchen Zeitungspapier eingelegt war. Oben auf der linken Seite stand nur der letzte Teil des Satzes, deshalb blätterte ich zurück und las den Absatz von Anfang bis Ende.
Vor einem guten Jahrhundert hatten meine Vorfahren väterlicherseits das verlassen, was damals Galizien hieß, den östlichsten Teil des österreich- ungarischen Kaiserreichs (heute die Westukraine), und sich in Bosnien und Herzegowina angesiedelt, das kurz zuvor von der Habsburgermonarchie annektiert worden war. Meine bäuerlichen Vorfahren brachten ein paar Bienenstöcke, Pflüge, ein paar Lieder über die verlassene Heimat und ein Rezept für einen vollkommenen Borschtsch mit, eine Speise, die bis dahin in diesem Teil der Welt unbekannt gewesen war.
Während des Lesens spürte ich, dass sich hinter meinem Rücken der Leichenbeschauer aufgestellt hatte und darauf wartete, dass ich ihm Platz mache, damit er die Totenflecke auf Großvaters Scheitel zählen, die Pupillenweite und Lichtdurchlässigkeit der Hornhaut messen könne, um festzustellen, wann der Tod eingetreten war, aber ich musste, genauso wie mein Großvater, den Absatz zu Ende lesen. Das war meine Verpflichtung, eine verspätete Entschuldigung für alle abgesagten Besuche. Ich wusste, dass diese Entschuldigung keinen Adressaten finden würde, aber ich fuhr mit dem Lesen doch so lange fort, bis ich zum letzten Wort gekommen war, bis zum letzten Buchstaben, und hörte genau dort auf, wo am Abend zuvor auch er aufgehört hatte.
„Wenige Menschen haben ein Buch neben dem Kopfkissen. Frauen vielleicht noch, aber Männer fast nie. Zeitschriften, Zeitungen, aber am liebsten haben sie die Fernbedienung bei der Hand. So sind die Zeiten. Die Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie sich mit Büchern die Bilder ihrer Träume selbst schaffen, dass sie mit Lesen ihre Fantasie entwickeln und pflegen, während das Fernsehen ihnen Bilder aufdrängt. Bilder, die wir uns beim Lesen von Büchern schaffen, sind unsere eigenen, im Fernseher hingegen sehen wir fremde. Die Fernsehprogramme üben eine Gewaltherrschaft über unsere Traumwelt aus. Alle Bilder, die wir sehen, gehen in unser Unterbewusstsein ein, deshalb werden wir immer zerstreuter und unruhiger. Die Bilder in unserem Unterbewusstsein sind Bilder des Grauens.“
Ich drehte mich um und sah einen jungen Mann aus Piran vor mir, der auf der kroatischen Seite der Grenze Arbeit gefunden hatte und der, vermutlich so unterwiesen, einen Respektabstand zum Trauernden einhielt, zu mir, dem er einen angemessen mitfühlenden Blick schenkte. Tode waren sein Beruf und er sprach ungezwungen, aber mit Ernsthaftigkeit in der Stimme, als würde er auch vor mir den Eindruck erwecken wollen, dass für ihn jeder Leichnam, den er sich ansehen kommt, eine neue Geschichte sei und er noch nicht der Abstumpfung erlegen sei, die die Routine mit sich bringt. Trotzdem schien mir, dass er, einem Regelbuch für Totenbeschauer folgend, die Stille, die sich vor seiner Ankunft angesichts des Leichnams ausgebreitet hatte, absichtlich füllte und dass die leeren Phrasen zu seinen Berufsaufgaben gehörten.
Mich kam es an, dieses Konzept zu zerschlagen, aufzuhören, ihm freundlich beizupflichten und ihn allen Ernstes zu fragen, wie seiner Meinung nach im Mittelalter all die unwirklichen Dunkelmännergestalten ins Unterbewusstsein der Menschen gelangt seien, die uns von mittelalterlichen Träumern überliefert sind, woraus seiner Meinung nach die Albträume vor dem Aufkommen von Film und Fernsehen entstanden seien, woher bei unseren fernen Vorfahren all die dreiköpfigen Drachen und einäugigen Menschenfresser stammten, wenn die sie nicht im Nachtprogramm des kommerziellen Fernsehens gesehen haben.
Aber ich ließ es doch schweigend zu, dass er an mir vorbei ans Bett trat, auf dem Großvaters Leichnam lag.
Großvaters Tod war mein erster. Ich wandte mich von dem Körper ab, der auf dem Bett lag und mich erschreckte. Mit den Augen überflog ich den Raum und suchte nach einem Eckchen, wohin ich meinen Blick lenken könnte, aber alles um mich herum sprach zu mir. Auf dem Esstisch lag Großvaters Fernsehbrille, nachlässig auf dem speckigen Tischtuch liegen gelassen. Unten lagen einige größere Krümel, die die unter den Tischrand gehaltene Hand verfehlt hatten. In der Zimmerecke lag ein Haufen alter Zeitungen, der tief unter sich einen längst überfüllten Korb verbarg. Vom Bettrand hing ein Strumpf, den er sich wohl in einer der vorhergehenden Nächte abgestreift hatte. Ich musste daran denken, dass in ihm vermutlich noch immer sein Geruch, sein Gestank eingefangen war, aber auch ein Loch oder zwei, das seine schlecht geschnittenen Fußnägel gemacht hatten. Auf dem Fußboden unter dem Fenster lagen zwei offene Bücher, die wer weiß wann vom Fensterbrett gefallen waren. Auf der anderen Seite des Zimmers stand neben dem Fernseher ein leeres Glas, höchstwahrscheinlich am verstaubten Schrank festgeklebt. Der Teppich war an einer Ecke umgeschlagen, und ich sah Großvater vor mir, wie er an ihm hängen bleibt. Zwei der vier Kommodenschubladen waren nicht ganz geschlossen, bei beiden hatte etwas geklemmt. Unter der Couch sah ich den Schattenumriss eines Löffels, der ihm vor ein paar Tagen vermutlich unbemerkt vom Tisch geflogen war. Oder er hatte, noch wahrscheinlicher, keine Lust gehabt, sich zu bücken, und ihn einfach dort liegen lassen. Großvater war überall, nur dort, auf dem Bett, wo er letztlich lag, war er nicht mehr. Er war nicht mehr hinter den entfärbten graugrünen Augen, nicht mehr hinter den in alle Richtungen strebenden weißen Augenbrauen und den Barthaaren, die sich jetzt zum ersten Mal ergeben ans Gesicht angelegt hatten. Ich saß unmittelbar neben sei- nem reglosen Körper, berührte ihn fast mit der Hand, war mir seines Todes aber noch immer nicht bewusst. Alles im Haus war so gleich, so alltäglich. Ein dichter Geruch nach Rauch füllte noch immer das Zimmer, Straßengeräusche kamen ungehindert durch die alten Fenster, und Staubteilchen tanzten in den Lichtgarben. Allem Anschein nach hatte sich seit meinem letzten Besuch nichts geändert. Nur Großvater war gestorben.
Das wiederholte ich mir, und das bestätigte auch der Totenbeschauer. Und Mutter nickte.
Als Großmutter starb, war alles anders gewesen. Damals kam ich erst nach dem Begräbnis ins Haus, als Mutter Großmutters Sachen schon aufgeräumt und das Haus schon gründlich saubergemacht hatte, so- dass von Großmutter nur das Bild über ihrem Bett geblieben war, auf dem sie sich überhaupt nicht ähnlich sah. Und zurückgeblieben war Großmutters Zahnbürste.
Mutter glaubte, dass der Tod das Leben nicht zum Stillstand bringen darf und dass man die Spuren des Verstorbenen so rasch wie möglich wegräumen, wegreiben, abwischen und abwaschen und Stück für Stück aus dem Haus tragen muss, so wie man zuvor den Leichnam weggetragen hat. So füllte sie nur einen Tag nach Großmutters Tod die alten Lederkoffer, die oben auf den Schränken geduldig auf ihre letzte Reise gewartet hatten, mit ihren Kleidern und brachte sie zur Caritas, Großmutters Bijouterie warf sie in eine Plastikbox für Speiseeis und schenkte sie der Enkelin der Nachbarin, und die Kosmetiksachen warf sie in den Müll.
Großvater sah ihr dabei die ganze Zeit nur stumm zu, und als Mutter aus dem Badezimmer zwei Zahnbürsten anbrachte und ihn fragte, welche seine und welche Großmutters sei, sagte er: Weiß nicht. In der Meinung, er hätte sie nicht verstanden, erklärte ihm Mutter, dass sie Großmutters Zahnbürste gern wegwürfe und er ihr bitte sagen solle, mit welcher er sich die Zähne putze. Aber Großvater verharrte bei seinem Weiß nicht. Mutter durchschaute die Lüge und wiederholte genauso hartnäckig ihre Frage, weshalb Großvater seine Antwort änderte. Beide sind meine. Bring sie ins Badezimmer zurück. Kannst du mir dann sagen, welche du lieber hast?, fragte sie ihn. Warum? Es hat keinen Sinn, dass du zwei Zahnbürsten hast. Ich kann so viele Zahnbürsten haben, wie ich will. Möchtest du, dass ich dir Mutters Zahnbürste zur Erinnerung lasse? Wenn ich etwas zur Erinnerung haben wollte, würde ich mir ein Kleid behalten. Oder eine Halskette. Ich habe dich gefragt, ob du etwas dagegen hast, wenn ich sie wegbringe. Ja. Und was hast du gesagt? Dass ich tun soll, was ich will, oder nicht? Ja. Und jetzt sagst du mir, du hättest gern eine Halskette oder ein Kleid behalten. Das habe ich nicht gesagt, Vesna. Was hast du dann gesagt? Ich habe gesagt, wenn ich etwas zur Erinnerung hätte haben wollen. Wenn. Und was ist das, wenn nicht ein Vorwurf? Das ist kein Vorwurf. Was ist es denn? Es ist kein Vorwurf. Wenn Mutter ein schlechtes Gewissen hatte, wurde sie bissig. Sie hielt Großvater die Zahnbürsten vors Gesicht. Du hast drei Sekunden, dich zu entscheiden, welche deine ist, denn nach drei Sekunden fliegt eine von den beiden direkt in den Müll. Ich habe beide gern. Drei, zwei, eins ...
Mutter ließ eine der Zahnbürsten los, sodass sie in den Müllbeutel fiel, in dem sie die ausgemusterten Sachen sammelte. Großvater sagte nichts, und Mutter dachte, dass die Geschichte mit den Zahnbürsten beendet sei, aber als sie am nächsten Tag zurückkehrte, stand in dem Becher im Badezimmer eine neue Zahn- bürste, die Großvater an diesem Morgen gekauft hatte und mit der er sich die Zähne bis zu seinem Tod putzte.
Jene alte aber, ob Großmutters oder Großvaters, jene, die nicht in Mutters Müllbeutel gelandet war, stand neben ihr, wurde aber nie mehr von jemandem benutzt. In dem roten Plastikbecher am Rand des mit Wasserstein und anderen Ablagerungen überzogenen Waschbeckens standen seither zwei Zahnbürsten. Und taten es noch immer.
„Einen schöneren Tod kann sich der Mensch kaum wünschen. Im Schlaf zu sterben bedeutet, ohne Schmerzen zu sterben. Das nennen wir einen königlichen Tod.“
So hatte der Totenbeschauer gesagt, während er sich im Vorzimmer langsam die Schuhe anzog. Er war einer von jenen, die die Schuhe ausziehen, auch wenn ihm die Hausbewohner klarzumachen versuchen, dass er es nicht zu tun braucht. Mutter schenkte ihm ein Kopfnicken, ich schloss die Tür hinter ihm, dann kehrten wir zu Großvater zurück.
In der Hand hielt ich noch immer das Buch.
Leseprobe Teil 2
1
Vom Schemel neben dem Bett, der Großvater auch als Nachttischchen diente, nahm ich das Buch und schlug es an der Stelle auf, wo zwischen den Seiten ein abgerissenes Stück Zeitung eingelegt war. Immer hatten ihm die aus Leder, Leinen oder Papier gefertigten Lesezeichen leidgetan, die anstatt in Büchern in unaufgeräumten Schubladen und anderen wüsten Ecken seines Hauses vor sich hin schimmelten, während ihre Aufgabe von Bleistiften, Zahnstochern, Münzen und anderen spitzen oder flachen Gegenständen, die gerade bei der Hand waren, wahrgenommen wurde. Sein spätes Leben war eine Ansammlung unbedeutender Details. Angetrocknete Flecken auf den Hemden, angeklebte Essensreste auf den Tellern, verschiedenfarbige Schnürsenkel, durchgebrannte Glühbirnen, angestoßene Gläser, ausgeschriebene Kulis, ungültige Ausweise, längst abgelaufene Horoskope, Schlüssel ohne Schlösser und Schlösser ohne Schlüssel, alles das waren für ihn nur Kleinigkeiten, die niemandem wehtaten und für die sich nicht lohnte, die ihm zugemessene Zeit zu vergeuden.
Wegen des Ablaufens der Stunden stöberte Großvater im Haus auch nie nach Sachen, die für einen bestimmten Zweck geschaffen waren, etwa um zwischen Buchseiten gesteckt zu werden, denn es gab für ihn und seinen selbstverordneten Gleichmut immer genügend andere Dinge in der Nähe, die ebenso wirkungsvoll diese oder eine andere, noch anspruchsvollere Aufgabe erfüllen konnten. Den Kaffee bewahrte er in einem Mayonnaiseglas auf, aus dem er ihn in die džezva schüttete, um ihn dann mit dem Griff des Gasanzünders umzurühren und in einen Joghurtbecher zu gießen, während Großmutters schöne Keramikgefäße für Zucker, Salz und Kaffee, die vergoldeten Kaffeelöffel und Porzellantässchen in der Vitrine Staub ansetzten.
Mutter konnte aus der Haut fahren, wenn er zur Kennzeichnung der Stelle, bei der er beim Lesen stehen geblieben war, seinen Personalausweis verwendete, dann das Buch mit ihm zusammen in die Bücherei zurückbrachte, woher er ihn erst zurückbekam, wenn das Buch erneut ausgeliehen worden war. Dann begab sie sich wütend auf die Jagd nach Lesezeichen, durchwühlte die Schubladen, verrückte die Sessel, Schränke und sogar den Kühlschrank, kroch auch unter die Tische und Betten und legte am Ende völlig außer Atem sieben Lesezeichen auf Großvaters Schemel und schärfte ihm ein, sie endlich auch zu verwenden. Gegen alle Erwartung versprach er ihr, es zu tun.
Aber Großvater las nur abends vor dem Schlafen, in der Nähe des Schemels, und nur wenige der Bücher, die er las, landeten auf ihm, sodass er schon bald wieder alles Mögliche zwischen ihre Seiten steckte, von Visitenkarten der Elektriker bis zu Reklamezetteln der Zeugen Jehovas. Meistens aber riss er einfach ein Stück von der Zeitung ab, und einmal, als er ein wirklich dickes Buch las, ragte aus ihm mehrere Monate lang eine Todesanzeige mit dem Foto der verstorbenen Julija Morosin heraus.
Ihr schicksalsergebenes Gesicht sah mich vom Tisch im Wohnzimmer an, von der Lehne an Großvaters Sessel, vom Ofen, von der Kommode im Vorzimmer, sogar vom Fußboden im WC. Mehrere Male zählte ich ihre achtundsiebzig Jahre, ihre drei Töchter nebst Familien und die Tage bis zum Begräbnis, bevor ich aus Rücksichtnahme meinen Blick vor ihr abzukehren begann, bis ich die arme Julija endlich ihrer postumen Pflichten entband und sie ganz im großväterlichen Stil durch die Hälfte eines Artikels über eine Segelregatta ersetzte.
Und obwohl die Dinge in seinem Haus eine unermessliche Freiheit genossen und die Badezimmerhandtücher sich auf dem Boden des Schlafzimmers sonnten und die Wörterbücher auf der WC-Muschel ruhten, war mein zerstreuter Großvater ein außerordentlich disziplinierter Leser. Seine Lektüre beendete er nie mitten auf der Seite, geschweige denn mitten im Satz. Wenn er las, ließ er sich nicht stören, auch wenn die Hausglocke läutete oder etwas Graupenähnliches auf dem Küchenherd brodelte. Ein Kapitel las er immer von Anfang bis Ende, und wenn die Kapitel zu lang waren, hörte er mit dem Lesen am Ende des ersten Absatzes auf der linken Seite auf. Deshalb war es einfach festzustellen, wo Großvater am Abend zuvor seine Lektüre beendet hatte, welcher Satz der letzte war, den er im Leben gelesen hatte.
Ich schlug das Buch, das ich auf dem Schemel vorgefunden hatte, dort auf, wo das Stückchen Zeitungspapier eingelegt war. Oben auf der linken Seite stand nur der letzte Teil des Satzes, deshalb blätterte ich zurück und las den Absatz von Anfang bis Ende.
Vor einem guten Jahrhundert hatten meine Vorfahren väterlicherseits das verlassen, was damals Galizien hieß, den östlichsten Teil des österreich- ungarischen Kaiserreichs (heute die Westukraine), und sich in Bosnien und Herzegowina angesiedelt, das kurz zuvor von der Habsburgermonarchie annektiert worden war. Meine bäuerlichen Vorfahren brachten ein paar Bienenstöcke, Pflüge, ein paar Lieder über die verlassene Heimat und ein Rezept für einen vollkommenen Borschtsch mit, eine Speise, die bis dahin in diesem Teil der Welt unbekannt gewesen war.
Während des Lesens spürte ich, dass sich hinter meinem Rücken der Leichenbeschauer aufgestellt hatte und darauf wartete, dass ich ihm Platz mache, damit er die Totenflecke auf Großvaters Scheitel zählen, die Pupillenweite und Lichtdurchlässigkeit der Hornhaut messen könne, um festzustellen, wann der Tod eingetreten war, aber ich musste, genauso wie mein Großvater, den Absatz zu Ende lesen. Das war meine Verpflichtung, eine verspätete Entschuldigung für alle abgesagten Besuche. Ich wusste, dass diese Entschuldigung keinen Adressaten finden würde, aber ich fuhr mit dem Lesen doch so lange fort, bis ich zum letzten Wort gekommen war, bis zum letzten Buchstaben, und hörte genau dort auf, wo am Abend zuvor auch er aufgehört hatte.
„Wenige Menschen haben ein Buch neben dem Kopfkissen. Frauen vielleicht noch, aber Männer fast nie. Zeitschriften, Zeitungen, aber am liebsten haben sie die Fernbedienung bei der Hand. So sind die Zeiten. Die Menschen sind sich nicht bewusst, dass sie sich mit Büchern die Bilder ihrer Träume selbst schaffen, dass sie mit Lesen ihre Fantasie entwickeln und pflegen, während das Fernsehen ihnen Bilder aufdrängt. Bilder, die wir uns beim Lesen von Büchern schaffen, sind unsere eigenen, im Fernseher hingegen sehen wir fremde. Die Fernsehprogramme üben eine Gewaltherrschaft über unsere Traumwelt aus. Alle Bilder, die wir sehen, gehen in unser Unterbewusstsein ein, deshalb werden wir immer zerstreuter und unruhiger. Die Bilder in unserem Unterbewusstsein sind Bilder des Grauens.“
Ich drehte mich um und sah einen jungen Mann aus Piran vor mir, der auf der kroatischen Seite der Grenze Arbeit gefunden hatte und der, vermutlich so unterwiesen, einen Respektabstand zum Trauernden einhielt, zu mir, dem er einen angemessen mitfühlenden Blick schenkte. Tode waren sein Beruf und er sprach ungezwungen, aber mit Ernsthaftigkeit in der Stimme, als würde er auch vor mir den Eindruck erwecken wollen, dass für ihn jeder Leichnam, den er sich ansehen kommt, eine neue Geschichte sei und er noch nicht der Abstumpfung erlegen sei, die die Routine mit sich bringt. Trotzdem schien mir, dass er, einem Regelbuch für Totenbeschauer folgend, die Stille, die sich vor seiner Ankunft angesichts des Leichnams ausgebreitet hatte, absichtlich füllte und dass die leeren Phrasen zu seinen Berufsaufgaben gehörten.
Mich kam es an, dieses Konzept zu zerschlagen, aufzuhören, ihm freundlich beizupflichten und ihn allen Ernstes zu fragen, wie seiner Meinung nach im Mittelalter all die unwirklichen Dunkelmännergestalten ins Unterbewusstsein der Menschen gelangt seien, die uns von mittelalterlichen Träumern überliefert sind, woraus seiner Meinung nach die Albträume vor dem Aufkommen von Film und Fernsehen entstanden seien, woher bei unseren fernen Vorfahren all die dreiköpfigen Drachen und einäugigen Menschenfresser stammten, wenn die sie nicht im Nachtprogramm des kommerziellen Fernsehens gesehen haben.
Aber ich ließ es doch schweigend zu, dass er an mir vorbei ans Bett trat, auf dem Großvaters Leichnam lag.
Großvaters Tod war mein erster. Ich wandte mich von dem Körper ab, der auf dem Bett lag und mich erschreckte. Mit den Augen überflog ich den Raum und suchte nach einem Eckchen, wohin ich meinen Blick lenken könnte, aber alles um mich herum sprach zu mir. Auf dem Esstisch lag Großvaters Fernsehbrille, nachlässig auf dem speckigen Tischtuch liegen gelassen. Unten lagen einige größere Krümel, die die unter den Tischrand gehaltene Hand verfehlt hatten. In der Zimmerecke lag ein Haufen alter Zeitungen, der tief unter sich einen längst überfüllten Korb verbarg. Vom Bettrand hing ein Strumpf, den er sich wohl in einer der vorhergehenden Nächte abgestreift hatte. Ich musste daran denken, dass in ihm vermutlich noch immer sein Geruch, sein Gestank eingefangen war, aber auch ein Loch oder zwei, das seine schlecht geschnittenen Fußnägel gemacht hatten. Auf dem Fußboden unter dem Fenster lagen zwei offene Bücher, die wer weiß wann vom Fensterbrett gefallen waren. Auf der anderen Seite des Zimmers stand neben dem Fernseher ein leeres Glas, höchstwahrscheinlich am verstaubten Schrank festgeklebt. Der Teppich war an einer Ecke umgeschlagen, und ich sah Großvater vor mir, wie er an ihm hängen bleibt. Zwei der vier Kommodenschubladen waren nicht ganz geschlossen, bei beiden hatte etwas geklemmt. Unter der Couch sah ich den Schattenumriss eines Löffels, der ihm vor ein paar Tagen vermutlich unbemerkt vom Tisch geflogen war. Oder er hatte, noch wahrscheinlicher, keine Lust gehabt, sich zu bücken, und ihn einfach dort liegen lassen. Großvater war überall, nur dort, auf dem Bett, wo er letztlich lag, war er nicht mehr. Er war nicht mehr hinter den entfärbten graugrünen Augen, nicht mehr hinter den in alle Richtungen strebenden weißen Augenbrauen und den Barthaaren, die sich jetzt zum ersten Mal ergeben ans Gesicht angelegt hatten. Ich saß unmittelbar neben sei- nem reglosen Körper, berührte ihn fast mit der Hand, war mir seines Todes aber noch immer nicht bewusst. Alles im Haus war so gleich, so alltäglich. Ein dichter Geruch nach Rauch füllte noch immer das Zimmer, Straßengeräusche kamen ungehindert durch die alten Fenster, und Staubteilchen tanzten in den Lichtgarben. Allem Anschein nach hatte sich seit meinem letzten Besuch nichts geändert. Nur Großvater war gestorben.
Das wiederholte ich mir, und das bestätigte auch der Totenbeschauer. Und Mutter nickte.
Als Großmutter starb, war alles anders gewesen. Damals kam ich erst nach dem Begräbnis ins Haus, als Mutter Großmutters Sachen schon aufgeräumt und das Haus schon gründlich saubergemacht hatte, so- dass von Großmutter nur das Bild über ihrem Bett geblieben war, auf dem sie sich überhaupt nicht ähnlich sah. Und zurückgeblieben war Großmutters Zahnbürste.
Mutter glaubte, dass der Tod das Leben nicht zum Stillstand bringen darf und dass man die Spuren des Verstorbenen so rasch wie möglich wegräumen, wegreiben, abwischen und abwaschen und Stück für Stück aus dem Haus tragen muss, so wie man zuvor den Leichnam weggetragen hat. So füllte sie nur einen Tag nach Großmutters Tod die alten Lederkoffer, die oben auf den Schränken geduldig auf ihre letzte Reise gewartet hatten, mit ihren Kleidern und brachte sie zur Caritas, Großmutters Bijouterie warf sie in eine Plastikbox für Speiseeis und schenkte sie der Enkelin der Nachbarin, und die Kosmetiksachen warf sie in den Müll.
Großvater sah ihr dabei die ganze Zeit nur stumm zu, und als Mutter aus dem Badezimmer zwei Zahnbürsten anbrachte und ihn fragte, welche seine und welche Großmutters sei, sagte er: Weiß nicht. In der Meinung, er hätte sie nicht verstanden, erklärte ihm Mutter, dass sie Großmutters Zahnbürste gern wegwürfe und er ihr bitte sagen solle, mit welcher er sich die Zähne putze. Aber Großvater verharrte bei seinem Weiß nicht. Mutter durchschaute die Lüge und wiederholte genauso hartnäckig ihre Frage, weshalb Großvater seine Antwort änderte. Beide sind meine. Bring sie ins Badezimmer zurück. Kannst du mir dann sagen, welche du lieber hast?, fragte sie ihn. Warum? Es hat keinen Sinn, dass du zwei Zahnbürsten hast. Ich kann so viele Zahnbürsten haben, wie ich will. Möchtest du, dass ich dir Mutters Zahnbürste zur Erinnerung lasse? Wenn ich etwas zur Erinnerung haben wollte, würde ich mir ein Kleid behalten. Oder eine Halskette. Ich habe dich gefragt, ob du etwas dagegen hast, wenn ich sie wegbringe. Ja. Und was hast du gesagt? Dass ich tun soll, was ich will, oder nicht? Ja. Und jetzt sagst du mir, du hättest gern eine Halskette oder ein Kleid behalten. Das habe ich nicht gesagt, Vesna. Was hast du dann gesagt? Ich habe gesagt, wenn ich etwas zur Erinnerung hätte haben wollen. Wenn. Und was ist das, wenn nicht ein Vorwurf? Das ist kein Vorwurf. Was ist es denn? Es ist kein Vorwurf. Wenn Mutter ein schlechtes Gewissen hatte, wurde sie bissig. Sie hielt Großvater die Zahnbürsten vors Gesicht. Du hast drei Sekunden, dich zu entscheiden, welche deine ist, denn nach drei Sekunden fliegt eine von den beiden direkt in den Müll. Ich habe beide gern. Drei, zwei, eins ...
Mutter ließ eine der Zahnbürsten los, sodass sie in den Müllbeutel fiel, in dem sie die ausgemusterten Sachen sammelte. Großvater sagte nichts, und Mutter dachte, dass die Geschichte mit den Zahnbürsten beendet sei, aber als sie am nächsten Tag zurückkehrte, stand in dem Becher im Badezimmer eine neue Zahn- bürste, die Großvater an diesem Morgen gekauft hatte und mit der er sich die Zähne bis zu seinem Tod putzte.
Jene alte aber, ob Großmutters oder Großvaters, jene, die nicht in Mutters Müllbeutel gelandet war, stand neben ihr, wurde aber nie mehr von jemandem benutzt. In dem roten Plastikbecher am Rand des mit Wasserstein und anderen Ablagerungen überzogenen Waschbeckens standen seither zwei Zahnbürsten. Und taten es noch immer.
„Einen schöneren Tod kann sich der Mensch kaum wünschen. Im Schlaf zu sterben bedeutet, ohne Schmerzen zu sterben. Das nennen wir einen königlichen Tod.“
So hatte der Totenbeschauer gesagt, während er sich im Vorzimmer langsam die Schuhe anzog. Er war einer von jenen, die die Schuhe ausziehen, auch wenn ihm die Hausbewohner klarzumachen versuchen, dass er es nicht zu tun braucht. Mutter schenkte ihm ein Kopfnicken, ich schloss die Tür hinter ihm, dann kehrten wir zu Großvater zurück.
In der Hand hielt ich noch immer das Buch.
Leseprobe Teil 2
Kommentieren








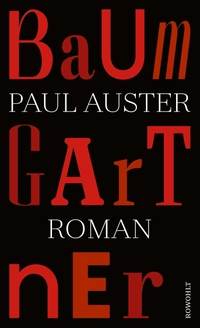 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung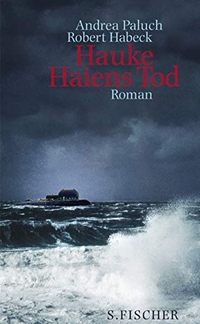 Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod
Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod